Heiko Eckard – Dienstag, 10. August 2021 – Ein Krieg der Geschichten – Am 24. Juli schrieb ich, “…dass ich dieses Blog fuehre, um Duterte zu verstehen. Ein Feldversuch, an dem ich nun gut 5 Jahre arbeite. Dies moechte ich mit einer zusammenfassenden Betrachtung abschlieszen, fuer die ich mir den Arbeitstitel “Mein Versuch Duterte zu verstehen” vorgenommen habe.”
Ich wollte mich unter Zugzwang setzen, bisher Geschriebenes durchzufloehen, um zu einer zusammenfassenden Sicht von Praesident Rodrigo Roa Duterte zu kommen.
Es hat nichts genutzt. Ich habe Tausende von Blog-Seiten nicht nochmal gelesen, aber – ich habe dazu geschrieben. Und da ich der Meinung bin, dass Duterte sich nicht mehr aendert, egal, ob er noch ein Amt als Vize anstrebt oder nicht, bringe ich das heute, weil auszer dem Coronavirus eh nichts los ist, und schenke mir den Rueckblick auf seine Amtszeit im naechsten Jahr.
Es geht dabei nicht so sehr um die Person, sondern um das Missverhaeltnis im Verstaendnis, wie er im Westen und wie er hier gesehen wird. Dazu hole ich weiter aus, aber das sind meine Leser gewohnt.
Tertium non datur – Die Mathematik hat es gut, in ihr gilt der Grundsatz “Wahr oder falsch, ein Drittes gibt es nicht (~ tertium non datur)”. Das ermoeglicht den “indirekten Beweis”: man nimmt an, das Gegenteil der Behauptung sei wahr, und – fuehrt die Annahme des Gegenteils zum Widerspruch – gilt das als Beweis der Behauptung.
Nun gibt es unter Mathematikern solche, die indirekte Beweise ablehnen und nur konstruktive Beweise anerkennen, die Schritt fuer Schritt von einer akzeptierten Basis ausgehend zu der fraglichen Behauptung fuehren. Diese “Konstruktivisten” sind nicht gut angesehen in der Mathematik – sie machen alles nur kompliziert.
Nein, es geht nicht um die Mathematik, sondern um eine Art des Denkens, das sich darin zeigt. Die Annahme eines Grundsatzes, wie z. B. des “tertium non datur”, der fuer das Objekt der Betrachtung gelten soll, bevor man sich ihm naehert, ist nichts als ein Vorurteil. Die Geschichte der europaeischen Philosophie ist eine Geschichte solcher Vorurteile, wie die Welt beschaffen sein muss, um erkannt werden zu koennen, von Platons Ideenlehre bis zu Kants “Kritik der reinen Vernunft”, der vielen dieser Vorurteile ein Ende bereitete.
Das Ende dieser Vorurteile bedeutete das Ende der Erkenntnistheorie – man kommt nicht durch welch angestrengte Art des Denkens auch immer darauf, wie oder was die Welt ist. Man waechst in sie hinein, und ab einem gewissen Alter beginnt mancher sich Gedanken zu machen, wie Goethe das im “Faust” so schoen ausdrueckte, “was die Welt im Innersten zusammenhaelt”. Bei mir begann das um mein 18. Lebensjahr herum. Hartkoepfig wie ich bin, studierte ich Philosophie und war danach, wieder frei nach Goethe, “so klug als wie zuvor”.
Erst zwanzig Jahre nach dem ersten Anlauf verstand ich mit Hilfe der “Philosophie der Geschichten” von Wilhelm Schapp, “wie Verstehen geht”. Fuer ihn gilt: “Geschichten sind der Horizont des Verstehens”.
Wir verstehen immer nur Geschichten, wir sind “in sie verstrickt”, und wenn wir mal die Welt nicht mehr verstehen, dann ist das blosz eine voruebergehende Irritation, die durch eine passende Geschichte aus der Welt geraeumt werden kann.
Auf diesem Wege kommen wir zu keiner Erkenntnis der Welt. Wir verstaendigen uns nur, wie wir damit umgehen wollen, was immer diese Welt auch sein mag. Philosophisch wird die Erkenntnistheorie von einer Verstaendnistheorie abgeloest.
Dies ist der Todesstosz fuer das “tertium non datur” – es gibt keine “eine Wahrheit”. Wahrheiten werden gesetzt. Es ist das, worauf man sich einigt. Und wird man sich mal nicht einig, dann gibt es halt mehrere. Wer sich allein auf eine beruft, unterscheidet sich nicht von Fundamentalisten – die haben immer nur eine, und wehe, man teilt die nicht!
Allerdings haben sich die Einsichten von Wilhelm Schapp nicht durchgesetzt. Nicht nur Philosophen – die Wissenschaften, die Politik, die Medien – sie alle haben ihre “Wahrheiten” zu lieb, als dass sie sie fuer “Geschichten” hergeben wuerden. In Social Media ist “Fact-checking” nachgerade Mode geworden, und die Print-Medien wollen da nicht nachstehen. Wohin man schaut, sind Investigativ-Journalisten am Werk und zerren eine Wahrheit nach der anderen ans Licht der jeweiligen Oeffentlichkeit.
Man muss vorsichtig sein. Rigoberto Tiglao schreibt in “The Manila Times”: “Hier ist eine Faustregel, die Sie sich zu eigen machen sollten … Glauben Sie den Berichten einer Zeitung nur, wenn diese über das eigene Land berichten, und das ist nicht einmal immer der Fall.”
Worauf ist aber Verlass, wenn man sich auf nichts verlassen kann?
Das ist die falsche Frage. Geschichten haben nur einen Anspruch: sie muessen passen, nicht einem, sondern mindestens zweien – dem Erzaehler und dem Zuhoerer. Die Philosophie der Geschichten als Verstaendnistheorie ist nichts fuer einsame Denker. Sie setzt voraus, dass neben dem Vortragenden mindestens einer da ist, der seine Gedanken durch diese Geschichte fuehren laesst. Man muss eine Welt verlassen, um in eine andere zu kommen.
Ich habe den Titel meines Blogs irgendwann umgestellt, “…aus der philippinischen Presse” wurde zu “Estorya lang ni Heiko ~ Geschichten von Heiko halt”. Und so richten sich meine Geschichten nicht an Westler, die sich ueber den Osten informieren wollen. Sie koennen die Lektuere hier beenden, ich habe ihnen nichts zu sagen.
Ich kann nur Geschichten erzaehlen, den Leser dies und das sehen zu machen, was mir auf meinem Weg von West nach Ost aufging. Laesst er sich darauf ein, koennte ihm aufgehen, dass es mehr als eine Wahrheit gibt: “tertium datur ~ es gibt ein Drittes”, ein Viertes, ein Weiteres…
Ein Krieg gegen Drogen – Den Krieg gegen Drogen, mit der groszspurigen Ansage, ihn in drei Monaten beenden zu wollen, verlor Rodrigo Roa Duterte, bevor er mit diesem Wahlversprechen im Mai 2016 zum Praesidenten gewaehlt wurde. Zu viele moerderische Worte waren gefallen, als dass noch jemand glauben konnte, dass es da mit rechten Dingen zuginge.
Glauben ist keine Frage des Wissens, sondern eine Frage des Wollens. Man glaubt, was ins Bild passt. Und was nicht ins Bild passt, blendet man aus. Geschichten zielen nicht auf “das” Bild der “wirklich wahren Welt”, sondern auf einen bequemen Umgang mit ihr. Man einigt sich auf ein Bild der Welt, sogar wenn man sich nur mit sich selbst einig wird.
Einfach zu oft hatte Duterte vor der Polizei gesagt: “Tut eure Pflicht, und wenn ihr dabei 1000 Personen erschießt, weil ihr eure Pflicht tut, werde ich euch beschützen.” Zur Festnahme von Verdãchtigen sagte er: “Und wenn es Widerstand gibt, der euer Leben in Gefahr bringt, dann schießt selbstverständlich und schießt ihn tot. Das ist mein Befehl.” Der Zusatz, “der euer Leben in Gefahr bringt”, ging unter, haengen blieb “schießt ihn tot”. Dazu kamen Faelle, in denen eben nicht “Dienst nach Vorschrift” gemacht wurde.
Im November 2016 wurde der Buergermeister von Leyte, Rolando Espinosa, von einem Polizei-Trupp in der Gefaengniszelle erschossen. Zu Tode kam bei einem “Feuergefecht” auch der Mitgefangene Raul Yap; kein einziger Polizist wurde verletzt. “Mit einem Wort: vorsãtzlich!” urteilte bei Untersuchung des Vorfalls Senator Panfilo Lacson. Dem ehemaligen Polizei-Chef stiesz auf, dass das Polizei-Kommando die Spurensicherung anrief, noch bevor sie das Gefaengnis betraten. Lacson: “Das ist so, als ob ihr das Beerdigungs-Institut ruft, bevor es eine Auseinandersetzung gab.”
Im Januar 2017 wurde der koreanische Geschaeftsmann Jee Ick Joo im Hauptquartier der Philippine National Police, Camp Crame, von den Polizisten, die ihn entfuehrt hatten, stranguliert und seine Leiche in einem Krematorium verbrannt, das einem Ex-Polizisten gehoert. Die Sache flog auf, als sie von der Witwe Geld erpressen wollte, die jedoch das National Bureau of Investigation informierte, als sie keinen Lebensbeweis ihres Gatten bekam.
Der Journalist Rigoberto Tiglao schrieb im Januar 2017 in “The Manila Times” unter dem Titel “How many police crimes haven’t been exposed?”. Das ginge von “smiling money”, was heiszt, dass man sich selbst noch im Spiegel sehen kann, wenn man fuer’s “Uebersehen” von Spielhoellen oder Massage-Salons, Prostitution ist in den Philippinen verboten, “Zuwendungen” annimmt, bis zum “crying money” aus knallharter Erpressung. Nun hat die Philippine National Police 160 Tsd Leute, und Duterte selbst schaetzte, dass um die 40% korrupt sind. Das waeren 64 Tsd Strolche (smiling money) oder Schurken (crying money).
Im August 2017 kam es zum Tod des Studenten Kian Loyd de los Santos, der – wie die Aufnahmen einer Ueberwachungskamera zeigten – von Polizisten in einen Hinterhof gefuehrt und erschossen wurde. Die Tat, fast vor laufender Kamera, war denn doch zuviel. Egal, was an Argumenten kam: fuer einige war die Polizei eine Bande, die Menschen hinrichtete, und fuer andere blieben sie unschuldig, bis die paar “Schurken” von einem Gericht verurteilt wurden.
Daran aenderte auch nichts, dass die Zahl der von Polizisten Getoeteten von Maria Ressas “Rappler” mutwillig erhoeht wurde, indem man die Zahl der ungeklaerten Todesfaelle addierte. Rigoberto Tiglao schrieb dazu im Dezember 2018 in “The Manila Times” unter der Ueberschrift “Thanks to Ressa and Coronel, PH press viewed as bad as in NKorea nd Myanmar”, dass er Sheila Coronel zu ihrem Artikel “A Presidency Bathed in Blood” anschrieb, wie sie auf die Zahl von 9 Tsd Opfern des Drogenkrieges kaeme. Coronel antwortete “zahlreiche Artikel zitieren diese Zahl”. Tiglao schrieb, diese “zahlreichen Artikel” basieren alle auf der erfundenen “Rappler”-Zahl. Darauf bekam er dann keine Antwort mehr.
Sheila Coronel ist Direktorin des Zentrum fuer Investigativen Journalismus an der Columbia-Universitaet in New York, und sie ist gut vernetzt. Coronel sorgte dafuer, dass Ressa den Press Freedom Award 2018 in New York bekam. Bei der Preis-Verleihung in New York war Amal Alamuddin Clooney anwesend, Anwaeltin fuer Menschenrechte, und die liesz sich von Maria Ressa informieren, wie es um die Presse in den Philippinen stuende. Clooney verkuendete spaeter bei einer Versammlung der Korrespondenten der Vereinten Nationen dies: “Der eisige Effekt ist wirklich und wird schon gefuehlt, nicht nur in Myanmar, doch in weiterem Feld wie bei dem autokratischen Regimen von Nord Korea bis zu den Philippinen.”
Wem glaubt man – dem der von Tausenden Toten spricht, die Duterte praktisch angekuendigt hatte, oder dem, der von gefaelschten Zahlen spricht?
In der Frage des Drogenkrieges war Duterte sich selbst der groeszte Gegner, und da er auch in drei, in sechs Monaten, in einem Jahr und bis heute den Krieg nicht gewann, ist es witzlos anzufuehren, dass Duterte die Kriminalitaet in seiner Amtszeit halbiert hatte, die sich unter seinem Vorgaenger verdreifacht hatte – das sind doch Zahlenspiele!
So gibt es zwei Geschichten zu Dutertes Krieg gegen Drogen. Die Geschichte seiner Gegner erzaehlt, dass er Menschen ermorden laesst, und die Geschichte seiner Anhaenger weisz, dass er die Kriminalitaet halbiert hat – man kann sich aussuchen, welche Geschichte einem passt.
Ein Krieg um hoehere Werte – Im Mai 2020 machte ich mir Gedanken unter der Ueberschift “Warum ich Nationalist geworden bin”. Da es keine Weltregierung gibt, die Rechte durchsetzen koennte, die ueber das Recht einer Nation hinausgehen, ist die UNO eine Schwatzbude. So bleibt die Nation das Rueckfall-Konzept aller Versuche, ueber sie hinaus zu kommen. Recht gibt es – wenn ueberhaupt – nur im Rahmen einer Nation, die das Gewaltmonopol hat und ausuebt. “Recht ohne Macht wird verlacht” – weisz der Volksmund.
Alles, was oberhalb nationaler Justiz angesiedelt ist, bleibt Politik, Ideologie oder Religion – Geschichten halt. Dass die sich als “hoehere Werte” ausgeben, ist Teil der Geschichte. Wer im Diesseits nicht gruenden kann, sucht sich eine Wertebasis “darueber”, von der aus er auf andere herabsehen kann. Das klappt in einer Glaubensgemeinschaft, selbst wenn es eine blosze Meinungsblase ist. Das klappt nicht, wenn es den Rahmen der Nation ueberschreitet.
Dagegen spricht, dass die USA, China und Russland das Rome Statute nicht unterschrieben, bzw. ihre Unterschrift zurueckgezogen haben, Grundlage des ICC (International Criminal Court). Diese Maechte lassen nicht zu, dass irgendjemand auszer ihren eigenen Gerichten Recht ueber ihre Buerger spricht, insbesondere wenn die als Soldaten und Polizisten dem jeweiligen Staat unterstellt sind. Sie sehen das als Einschraenkung ihrer Souveraenitaet.
So setzt der ICC im Haag die Kolonialherrschaft mit anderen Mitteln fort und schwingt sich zum Richter ueber Staaten vornehmlich in Afrika auf. Doch nicht nur die trifft es.
Nachdem die hiesige Opposition mit dem Antrag zur Amtsenthebung von Praesident Rodrigo Roa Duterte wegen der Mehrheitsverhaeltnisse scheiterte, reichte sie eine Kommunikation beim ICC ein, die ihm Menschenrechts-Verbrechen unterstellte. Darauf kuendigte Praesident Duterte das Rome Statute und kehrte dem ICC den Ruecken. Der Anwalt, Jude Sabio, der die Kommunikation 2017 eingereicht hatte, zog sie spaeter zurueck mit der Begruendung, er sei einer politischen Intrige aufgesessen. Das war kein Anlass fuer die Klaegerin, Fatouh Bensouda, auf den Antrag zu einer ordentlichen Untersuchung zu verzichten.
Hier stellt sich die Frage, wenn es Verbrechen gab, wurden die in den Philippinen angezeigt? Der ICC ist nur zustaendig, wenn es im fraglichen Land keine funktionierende Rechtsprechung gibt. Ob dies aber der Fall ist, ist wieder so eine Geschichte. Wenn die Opposition mit der Amtsenthebung scheitert, sucht sie sich eine andere Instanz, in der Hoffnung, dann eben dort Recht zu bekommen. Unter Juristen ist das als “forum shopping” bekannt – kommt man vor diesem Gericht mit der Klage nicht durch, rennt man zur hoeheren Instanz und versucht es da.
Dass die Rechtsprechung in den Philippinen jedoch funktioniert, bewies der “Judgment Day” vom 19. Dezember 2019, als Richterin Jocelyn Solis-Reyes im Fall des Ampatuan-Massakers ihr Urteil sprach. Dieser Spruch zur Ermordung von 58 Personen, darunter 32 Journalisten, die im Jahre 2009 zur Anmeldung einer Wahl-Kandidatur auf dem Weg waren, wurde weltweit beobachtet und von der UNESCO als “resolved ~ aufgearbeitet” betrachtet.
Es fragt sich, ob hier Geschichten vermengt werden, die unabhaengig voreinander gewachsen sind. Die Sprache Dutertes ist nicht dazu angetan, ihn vorab als einen “umgaenglichen Typ” oder gar “netten Kerl” einzuschaetzen. Seine Rede trieft nicht nur von Blut, sie ist auch selten “politisch korrekt”.
Als Duterte 2016 vor seiner Abreise zum ASEAN-Gipfel in Vientiane darauf angesprochen wurde, dass Praesident Barack Obama mit ihm ueber Menschenrechte reden wolle, sagte er: “ Ich bin der Präsident eines souveränen Staates, und wir sind schon lange keine Kolonie mehr. Ich habe keinen anderen Herrn als das philippinische Volk, aber auch wirklich keinen. Du musst Respekt haben. Du kannst nicht einfach mit Fragen und Aussagen kommen.”
Und dann kam im Nachsatz dieses “putang ina”, das ihm medial das Genick brach. Woertlich uebersetzt heiszt es, dass “die Mutter eine Hure” ist. Es wird in den Philippinen jedoch so verwendet, wie z.B. der ebenso unfeine Ausdruck “Scheisze” im Deutschen, nicht aber als Beleidigung. Es gibt sogar eine Entscheidung des hiesigen Obersten Gerichts, dass dieses “putang ina” eine blosze Unmutsaeuszerung ist, doch – wen interssiert das Oberste Gericht in den Philippinen?
Wichtig ist nicht, wie Filipinos ueblicherweise den Ausdruck verstehen, sondern wie die von den Medien gewaehlte woertliche Uebersetzung “son of a bitch” im Westen ankommt. Da fragt keiner nach dem landesueblichen Sprachgebrauch, nach dem Obersten Gericht gleich gar nicht.
Wer auf Menschenrechte angesprochen darauf mit “Hurensohn” antwortet, dem traut man zu, dass er sich auch nicht um sie kuemmert, wenn es um Drogenkriminalitaet geht, da er mit seinem Reden ein Klima schafft, das die Mordlust anfacht – hat er doch selbst gesagt – “schieszt sie tot!”
Und dass mal ein gerechtes Urteil gesprochen wird, wird dann auch nicht als Regel erachtet, sondern als Ausnahme von derselben.
Wenn Duterte sich in seiner State of the Nation Address 2018 gegen Menschrechtler mit den Worten: “Eure Bedenken kreisen um Menschenrechte, meine um Menschenleben” zur Wehr setzt, kommt das gar nicht mehr an. Man hat sich sein Bild von ihm gemacht, und dann ist das halt das uebliche Blah-blah, das Praesidenten zu solchen Anlaessen eben von sich geben.
Dagegen halten die, die hinter Duterte stehen, dass jene, die gegen Duterte vor den ICC gezogen sind, selbst fragwuerdige Gestalten sind. Der Ex-Senator Antonio Trillanes, ein Rebell, den Praesident Benigno Aquino aus dem Gefaengnis holte, der Schmutz-Kampagnen gegen Duterte organisiert und finanziert hat, wegen Verleumdung verurteilt – wer nimmt ernst, was der anderen vorwirft?
Und so hat man auch hier wieder Geschichten, aus denen man waehlen kann, welche einem am besten passt.
Die un-eine Welt – Wir leben nicht in einer Welt, die – frei nach Ludwig Wittgenstein: “Die Welt ist alles, was der Fall ist” – aus “Tatsachen”, verstanden als pruefbare Fakten, besteht.
Denn – was ist der Fall?
Schon die Suche nach dem Ursprung des Corona-Virus, eine rein wissenschaftlich-biologische Frage, entpuppte sich als ideologischer Krieg der Welten, in dem es nicht um Fakten, sondern einzig um die Deutungshoheit in dieser Frage ging.
Wir leben in Meinungsblasen, in denen vermeintlich Gleichgesinnte zueinander finden. Dies einzusehen, muss man das Vorurteil ablegen, Meinungsblasen seien etwas Unanstaendiges, das nur in vertrollten Social Media vorkommt. Ob man ueber den Gartenzaun, durch Zeitungslektuere oder per Smartphone teilnimmt, ist unerheblich. Wichtig ist nur, dass man sich damit auf “eine Welt” einigt, in der man sich versteht.
Man sollte jedoch nicht vergessen, dass diese “eine Welt” nicht die einzige “eine Welt” ist. Davon gibt es Tausende. Manche sind so klein wie die Facebook-Gruppe, in der ich schreibe, andere sind so grosz wie “der Westen”, der Duterte nicht versteht, oder “Dutertes Welt”, die nicht versteht, warum man sich mit ihm nicht verstaendigen will.
Das westliche Denken setzt die Welt als Fundus entscheidbarer Fragen voraus. Seit Alan Turing 1936 “On Computable Numbers, with an Application to the ‘Entscheidungsproblem’” veroeffentlichte, sollte bekannt sein, dass das nicht mal in der Mathematik gilt. Es gibt dort nicht entscheidbare Fragen, wieviel mehr in der wirklich wahren Welt!
Die Philosophie der Geschichten schert sich nicht darum, “was die Welt im Innersten zusammehaelt”. Es genuegt, sich zu verstaendigen, wie man mit ihr umgehen will. Dafuer muss man nicht Recht haben wollen, sondern Zuhoeren koennen. Das ist der Widerstreit von “verstehen” und “verstaendigen”. Man versteht etwas ganz allein fuer sich durch Erkenntnis, verstaendigen kann man sich nur miteinander durch Geschichten.
Der Schritt von der Erkenntnis- zur Verstaendnis-Theorie ist, wie eingangs erwaehnt, nicht leicht: die Philosophie, die Wissenschaften, die Politik, die Medien – sie alle haben sich ihm verweigert.
Besonders krass wurde mir dies klar, als ich vor rund 30 Jahren einem Schulfreund, der wie ich auch Philosophie studiert hatte, meine Sicht der Philosophie der Geschichten vorstellte. Sein erster und – seiner eigenen Meinung nach – vernichtender Einwand war: “Aber du hast ja gar kein Wahrheits-Kriterium!” Ich fand das nicht schlimm, fuer ihn war das die Katastrophe, und damit war ich fuer ihn – philosophisch – gestorben, nicht mehr ernst zu nehmen. Ich erinnerte mich an diese Szene, als ich neulich Tiglao zitierte, der in seiner Kolumne feststellte: “In der Schule wurde uns beigebracht, dass Atome nur aus drei Teilchen bestehen, jetzt sagt uns die moderne Physik, dass es 36 sind.” Fuer mich ist das der schoenste Beweis, dass sich auch die “Wahrheit der Atome”, schaut man nur naeher hin, schlieszlich in Geschichten aufloest.
Ich weisz, ich weisz, jetzt kommt der Einwand, dass dann ja auch die albernste Verschwoerungs-Theorie mit dem Anspruch auf Wahrheit auftreten kann. Erstens tut sie das bereits – sie kann also – und zweitens ist das die falsche Sichtweise: auch sie loest sich am Ende in Geschichten auf, die keine Wahrheit beanspruchen koennen.
Was hinter diesem Ringen um die unverzichtbare Wahrheit steckt, ist eine vermutete Beliebigkeit der Geschichten. Das ist aber nicht der Fall.
Geschichten muessen passen, und dies ist ein weit anspruchsvolleres Kriterium als eine sogenannte Wahrheit, die sich am Ende wieder dahingehend aufloest, dass vor einem Gerichtshof jemand die Hand hebt und schwoert, dies sei die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit – eine bekannte Geschichte.
Es passt ins Bild, dass Wilhelm Schapp neben der Philosophie auch Recht studiert hatte. Er war kein Philosophie-Lehrer an einer Universitaet, sondern verdiente seine Broetchen als Rechtsanwalt und Notar in Aurich. Und es war vor Gericht, als ihm auffiel, dass alles am Ende in Geschichten aufgeht. Nicht der Mann steht vor Gericht, sondern “die Geschichte steht fuer den Mann”, und die wird beurteilt und – in der wirklich wahren Welt – verurteilt oder freigesprochen, und mit ihr halt auch der Mann.
Die Welt ist doch schon eine Welt widerstreitender Geschichten – warum geben wir es nicht zu?
So auch Rodrigo Duterte. Ob dies oder jenes wahr ist, was er sagt oder was ihm vergeworfen wird, fuellt die Blaetter und verursacht grosze Aufregung. Doch das treffendste Urteil, das ich ueber ihn hoerte, nennt ihn nicht einen “guten Praesidenten” oder was auch immer, sondern stellt schlicht fest, dass er in dieser Zeit und fuer dieses Land der rechte Mann war – er passte den Philippinen.
Und, den Faden von “verstehen” und “verstaendigen” wieder aufgreifend, sehe ich an Rodrigo Duterte das Bemuehen um Verstaendigung. Geradezu tragisch sein Bemuehen um die Kommunisten, denen dieses Bemuehen abging, und im Westen ist ein solches Bemuehen leider auch nicht zu erkennen. Man hat dort eigene Wahrheiten und feiert sich dafuer. Selbst das ist eine moegliche Geschichte.
Mir ging bei dem Versuch Duterte zu verstehen erst unterwegs auf, dass ich damit scheitern musste. Ich kam ihm, was die Erkenntnis betrifft, eben nicht naeher, sondern ich entfernte mich im Verstaendnis vom Westen.
Tja, auch die Geschichte hat ihre zwei Seiten.



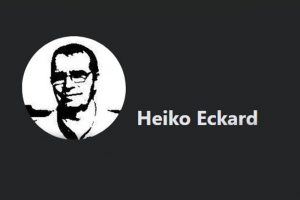

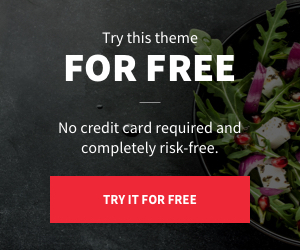
Add Comment