Manila – Wie die Philippinen geplündert und Schweizer Banken reicher wurden, ein Artikel vom 31. Mai 1987, geschrieben von dem Spiegel-Redakteur Joachim Preuß.
Potenciano Roque konnte wirklich nicht wissen, dass er in jener Februarnacht des Jahres 1986 die Welt des großen Geldes umkrempeln würde. Etwa um Mitternacht hatte der Sicherheitsbeamte in Manila einen Auftrag bekommen, der einerseits ungewöhnlich war, andererseits aber der verwirrenden politischen Lage entsprach: Roque sollte den Regierungspalast Malacañang durchsuchen, aus dem zwei Stunden zuvor der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Hals über Kopf vor seinen aufgebrachten Landsleuten geflohen war.
Gegen zwei Uhr morgens, inzwischen war der 26. Februar angebrochen, erreichte Roque die präsidialen Gemächer. Joker Arroyo, der engste politische Vertraute der neuen Präsidentin, Cory Aquino, schleuste den Sicherheitsmann an den allgegenwärtigen Militärs vorbei und verabschiedete sich dann, um zu Hause etwas Schlaf nachzuholen.
Als Potenciano Roque das Schlafzimmer des entkommenen Diktators betrat, schien er in eine Krankenstation zu kommen. Neben dem verstellbaren Hospitalbett stand ein Latrinenstuhl, auf dem ein angebrochenes Paket Windeln lag. Doch Roque interessierte sich weniger für die medizinischen Utensilien des nierenkranken Ex-Potentaten.
Die rollende Garderobenstange, auf der die vermeintlich glücksbringenden Hemden des abergläubischen Marcos hingen, fesselten seine Aufmerksamkeit nur kurz ebenso wie der graue, motorisierte Spielzeug-Mercedes eines Marcos-Enkels, der quer im Schlafzimmer parkte. Der Sicherheitsbeamte strebte zu einer offenstehenden Tür in der Zimmerecke, die den Blick freigab auf einen kleinen Vorraum, der in einer Treppe zum Garten mündete.
Später rekonstruierten Aquino-Beamte, daß Ferdinand Marcos durch diese Tür, die täuschend unscheinbar in die hölzerne Wandverkleidung eingepasst war, seine Flucht angetreten hatte. Es hatte schnell gehen müssen. Auf einer Schiefertafel, zwei Zimmer nebenan, waren noch mit weißer Kreide die letzten Truppenbewegungen in Manila aufgemalt. Das Abendbrot-Geschirr stand unaufgewaschen auf dem Tisch.
Marcos, seine Frau Imelda und die Gefolgsleute hatten Dutzende von Kisten und Koffer gepackt und über die verschwiegene Treppe ins Freie gebracht. Am Ufer des Pasig Rivers, der das Präsidenten-Anwesen begrenzt, hatten kleine Boote Geld, Schmuck, Edelsteine und Papiere über das Wasser geschippert. Auf der anderen Seite warteten die Hubschrauber der amerikanischen Freunde, die den Tross auf den philippinischen US-Stützpunkt Clark Air Base schafften.
Die Hast des Aufbruchs kam Potenciano Roque bei seinen Bemühungen entgegen: Familie Marcos hatte es nicht mehr geschafft, alle Spuren ihrer Herrschaft zu beseitigen.
Zwar wiesen zwei verkohlte Feuerstellen den Ort, wo Marcos, wie sich herausstellte, private Korrespondenz verbrannt hatte. Zwar zeigten drei defekte Reißwölfe an, dass Unmengen von Papier vernichtet worden waren. Aber in den zwanzig Jahren der Marcos-Herrschaft hatte sich zu viel angesammelt.
Als der erfahrene Polizist den Aktenschrank in dem kleinen Vorraum neben der Treppe aufzog, fand er die Kombination für den Safe neben der Tür. Roque öffnete den Panzerschrank und hielt in Händen, was fortan neben dem Marcos-Clan weltweit Dutzende von Anwälten, Richtern, Bankiers und Politikern auf unbestimmte Zeit in Atem halten würde: Hunderte von Papieren, die Hinweise auf die seltsamsten Geschäfte, auf Schweizer und New Yorker Bankkonten, auf Firmen in der Karibik enthielten.
Potenciano Roque hatte Indizien für einen der größten Raubzüge der Geschichte gefunden. Anders als beim römischen Feldherrn Marcus Licinius Crassus oder beim spanischen Eroberer Hernando Cortez, die ihre goldene Beute hatten schleppen lassen müssen, nutzte Ferdinand Marcos die Errungenschaften des 20. Jahrhunderts: den bargeldlosen Zahlungsverkehr und die verschwiegenen Experten eines kleinen Bergvolks, die gut 10.000 Kilometer westlich im Herzen Europas wohnen, die Schweizer Bankiers.
Es dauerte bis gegen fünf Uhr morgens, dann hatte Potenciano Roque die Papiere grob sortiert. Alarmiert von seinem aufregenden Fund, klingelte er Joker Arroyo wieder aus dem Bett, um ihm die Akten zu zeigen. Dann fuhr er selbst mit den Unterlagen nach Hause, schlief kurz und schlecht und brachte die Papiere zur sicheren Verwahrung in den Safe eines großen Bürogebäudes in Manila.
Seit Ferdinand Marcos in seinen frühen Jahren einmal eine wichtige Wahl mit 777 Stimmen gewonnen hatte, glaubte er fest daran, dass die Sieben seine Glückszahl sei. Sooft es ging, achtete er später darauf, dass seine diversen Nummernkonten in Hongkong, der Schweiz oder sonst wo auf der Welt eine Sieben enthielten. Aber dem 25. 2. 1986 fehlte nun wirklich jede Sieben: Alles ging schief.
Den abgehalfterten Diktator quälte eine böse Grippe, als er in einen der vier H-3-Helikopter der US-Luftwaffe kroch, die ihn nach dreißigminütigem Flug zur Clark Air Base brachten. Noch glaubte er, in seine Heimatprovinz Ilocos Norte weiterfliegen zu können. Doch die Amerikaner waren dagegen und erzählten Marcos, dass der angepeilte Flughafen keine ausreichende Beleuchtung für einen Nachtflug besitze.
Während die 89-köpfige Marcos-Korona wartete, kamen die Amerikaner endgültig mit Cory Aquino überein, dass Marcos besser das Land verlassen sollte. Ronald Reagan ließ seinen Freund über einen Vertrauten, Senator Paul Laxalt wissen: “Machen sie Schluss, die Zeit ist gekommen.”
Die besorgten amerikanischen Freunde hatten ein Hospital-Flugzeug vorbereitet. Offenkundig fürchteten sie, dass die überstürzte Reise zum US-Pazifik-Stützpunkt Guam dem Ex-Präsidenten an die ohnehin schwachen Nieren gehen könnte. Die Entourage folgte in einem Transportflieger des Typs C-141.
Schließlich war eine zweite C-141 nötig: Gold, Schmuck, Juwelen und frisch gedruckte philippinische Pesos mussten mit. Hatte Reagans Laxalt nicht versprochen, dass der Abgang “mit Würde” vonstattengehen würde?
Die Zöllner auf der Hawaii-Insel Honolulu, wo die Reisegesellschaft schließlich landete, mussten den Eindruck gewinnen, dass ein Juwelier der Weltspitze unterwegs war. Auf 23 engbedruckten Seiten notierten sie “die Artikel, die die Marcos-Gesellschaft begleiteten”. Aus dem braunroten Lederkoffer “777” purzelten allein 93 Kostbarkeiten – Perlen, Ohrringe, Armbänder.
Ein brauner Alligatorsack enthielt neben einigen zierlichen Diademen eine atemraubende Kombination aus Ohrringen, Brosche und Armreif. Den Wert der Saphire, Rubine und Diamanten allein dieses Sets veranschlagten die Zöllner mit knapp 1,5 Millionen US-Dollar.
Insgesamt 15 Koffer und Reisetaschen, meist aus den Häusern Louis Vuitton oder Gucci, leerten die Beamten. Die Bilder glichen sich – Berge von Geschmeide und Dutzende von Uhren: Patek Philippe und Chopard, reichlich Ware von van Cleef, Cartier und Rolex.
Schließlich machten sich die Beamten an weitere 22 Holzkisten. Meist in braunes Packpapier gehüllt, kamen druckfrische Pesos im Wert von mehr als einer Million Dollar zum Vorschein.
Die Funde auf der Pazifik-Insel, in all ihrer Pracht dem normal Sterblichen allenfalls aus den Märchen von 1001 Nacht vertraut, machten einen Mangel des modernen Geldverkehrs oder zumindest eine Eigenart des geflohenen Potentaten deutlich: Wenn wirklich Not am Mann ist, scheint das Vertrauen in Kreditkarten, Travellerschecks und Zinscoupons begrenzt. Statt Papier sind Gold, Geld und Diamanten gefragt.
Die Durchsuchung ergab überdies, dass Potenciano Roque bei seiner nächtlichen Fahndung längst nicht alle Papiere gefunden hatte, die dem Reißwolf entgangen waren.
Die Zöllner in Honolulu stellten Tausende von Aktenblättern sicher. In der Eile des Aufbruchs hatte der Diktator, offenkundig ziemlich wahllos Dokumente im Palast zusammengerafft und mitgenommen.
Verträge, Bankbelege und Kontoauszüge aus Hongkong, der Schweiz und jenen verschwiegenen Steueroasen mit so klingenden Namen wie Virgin oder Cayman Islands belegten die rege Geschäftstätigkeit des philippinischen Herrschers.
Der Mann, auf dessen Schreibtisch sich all diese Papiere bald stapelten, trägt die Narben, die Ferdinand Marcos seine Diktatur auf den Philippinen hinterlassen hat, auf seiner Haut. Jovito Salongas rechte Hand ist verkrüppelt, das linke Auge ist zerstört. Die Bombe auf der Plaza Miranda in Manila im Jahre 1971, die den Führern der Liberalen Partei galt und bald darauf das Kriegsrecht auf den Philippinen einleitete, hat sein Gehör beschädigt und Splitternarben in seinen Körper gegraben.
Mit ihrer ersten Amtshandlung hatte Cory Aquino den 66-jährigen Rechtsanwalt damit beauftragt, die geraubten Marcos-Milliarden zurückzubringen. Salongas Einsatztruppe, die dieses Wunder vollbringen soll, heißt “Kommission für gutes Regieren”. Der Name soll auf den schier hoffnungslos korrupten Philippinen ein Signal setzen.
Auf den Fluren des Kommissions-Büros, das an ein westdeutsches Einwohnermeldeamt erinnert, hängen aufmunternde Plakate. “Ein paar Gramm Loyalität wiegen schwerer als ein Pfund Cleverness”. Ein “Aufruf zur Ehrlichkeit” gibt bekannt, “dass wir ein neues Zeitalter der Moral beginnen”.
Jovito Salonga, der einst gemeinsam mit dem Deutschen Karl Carstens an der US-Universität von Yale Jura studierte, musste bei seiner Schatzsuche von vornherein mit einem schweren Handicap kämpfen. Während Marcos seine Plündereien im Dunkeln des Kriegsrechts abwickelte, muss Salonga den Rechtsweg einhalten.
Das brachte schon zu Hause Ärger. Als seine Kommission Hunderte von Ländereien, Firmen, Privatflugzeugen und Konten beschlagnahmte, pochte so mancher zurückgebliebene Marcos-Zögling auf die dünne Rechtsgrundlage. Als Salonga die Duty-Free-Shops, eine bevorzugte Einnahmequelle von Marcos Gattin Imelda, vorübergehend schließen ließ, stellten sich sogar Marcos-treue Soldaten in den Weg.
Der amerikanische Kongressabgeordnete Stephen Solarz nannte das Ehepaar Marcos “Kleptokraten” und “Weltklasse-Schieber”. Jovito Salonga, der inzwischen in den Senat gewählt wurde, fand im “englischen Wörterbuch keinen Begriff”, der die Taten ausreichend benannte. Entsprechend gäbe es auch keine Gesetze. Er erinnerte an Charles de Gaulle, der nach dem Kriege kurzerhand die Vermögen der französischen Kollaborateure beschlagnahmt hatte. Und Chinas Mao Tse-tung habe die Reichtümer des geflohenen Tschiang Kaischek ebenso schlicht vereinnahmt. Warum also sollten die Filipinos anders verfahren?
Ferdinand Marcos und seine engsten Freunde – die “Cronies”, wie sie auf den Philippinen heißen – hatten das Land auf eine bislang unbekannte, zielstrebige Weise ausgeplündert.
Der Chef selbst, der unter Eingeweihten als “Mister 15 Prozent” galt, bediente sich stets zuerst. Er leitete Kriegsreparationen aus Japan ebenso auf seine Konten wie Darlehen der Weltbank. Seine Mafia machte sich die Kokosnuß-Industrie ebenso untertan wie die Zucker-, Bananen- oder Transportgeschäfte. Wenn die Philippinen auf den Weltmärkten zu teuer einkauften oder zu billig verkauften – stets flossen die Differenzen zu den Marktpreisen in den Geldkreislauf des Clans.
Schließlich, als er neben seinen Kreditinstituten auch die Nationalbank kontrollierte, praktizierte Ferdinand Marcos die Vermögensmehrung in reinster Form: “Wenn es keine Geschäfte gab”, sagt der philippinische Ex-Bankier Antonio Gatmaitan, “druckte er sich das Geld selbst.”
Das monetäre Schlaraffenland litt freilich an einem gravierenden Mangel – es war zu eng. Selbst wenn Marcos das ganze Südchinesische Meer mit seinen philippinischen Pesos hätte füllen können: Bei seinen Freunden, den Kaschoggis und Fords, den Filmstars und Königen, konnte er erst mitmischen, wenn er auch bei ihnen bezahlen konnte. Ferdinand und Imelda Marcos brauchten harte Währung.
So kam es, dass der “selbsternannte Führer der Dritten Welt”, wie ein philippinischer Regierungsbeamter sarkastisch sagt, seine Beute “nicht in Indien oder Pakistan” unterbrachte, sondern in die Heimat, der Dollar und der Schweizer Franken schleppte.
In den siebziger Jahren, so berichtet ein Bankier in Manila, habe die Marcos-Crew die zwanzig größten Banken der Welt auf ihre Tauglichkeit bei dem Versteckspiel untersucht. Sechs große japanische Kreditinstitute seien ausgeschieden. Marcos habe den alten Kriegsgegnern aus dem benachbarten Inselreich nicht getraut- auch wenn japanische Großkonzerne wie Mitsubishi, Marubeni und Mitsui stets exakt die vereinbarten Schmiergelder gezahlt hätten.
Es blieben die großen US-Banken, allen voran zunächst Rockefellers Chase Manhattan. Die britische Standard Chartered Bank machte sich durch ihren tadellosen Service im benachbarten Hongkong unentbehrlich. Aber in dem wuseligen Finanzzentrum Asiens, an dem so viele Schwarzgeld-Milliarden herumkreiseln, hielten selbstverständlich auch die Schweizer Bankiers ihre helfenden Hände geöffnet – vornan der Schweizerische Bankverein und die Schweizerische Kreditanstalt.
Wer mit Geld handelt, ist stets in Eile. Die ständige Drohung, daß irgendwo auf der Welt etwas passiert, das unmittelbar auf die dritte Stelle hinter dem Komma durchschlägt oder eine Aktie in den Keller reißt, hat die fixe Branche geprägt. Geldhändler reden in Kürzeln, und die Schweizerische Kreditanstalt heißt demzufolge SKA.
Gemeinsam mit dem Tessiner Grenzstädtchen Chiasso steht die SKA für die bislang abenteuerlichste Geldgeschichte, die aus den Couloirs des schweizerischen Bankwesens an die Öffentlichkeit drang.
In den siebziger Jahren hatten SKA-Manager weit über eine Milliarde Mark an italienischen Fluchtgeldern auf ungewöhnlichsten Wegen, zum Teil in Müllcontainern, auf ihre Konten bugsiert. Anschließend hatte das Geld in einem undurchsichtigen Firmendickicht einen neuen Nistplatz gefunden. Am Ende gingen die Firmen pleite: “Das Geld war weg. Die Italiener konnten sich aus Angst vor ihren Devisenfahndern nicht lauthals beschweren, und die SKA war blamiert.”
Eines der großen Geldhäuser, diese Monumente beharrlicher Solidität, war bei halsbrecherischen, kriminellen Geschäften erwischt worden.
Für die Schweizer Banken war Chiasso eine Katastrophe. Und doch blieb die Affäre, gemessen an dem Unheil, das Ferdinand Marcos über das eidgenossische Bankensystem bringen sollte, ein Betriebsunfall. Ein blöder Zufall hatte die Sache ans Tageslicht gefördert, mangelnde Vorsicht und Dummheit eines Filialleiters konnten zur Erklärung dienen – ein peinlicher Einzelfall eben.
Doch am 24. März des Jahres 1986, vier Wochen nach der Marcos-Flucht, ereignete sich in der Schweiz etwas Unerhörtes: Die SKA verpfiff einen ihrer besten Kunden. Und sie tat es in bester Absicht.
Am Paradeplatz in Zürich, der Zentrale der Bank, tauchte ein philippinischer Geschäftsmann mit dem klingenden Namen Michael Cesar de Guzman auf. Wichtiger als der Besucher war das Stück Papier, das er mit sich führte: eine nur wenige Tage alte Vollmacht von Ferdinand Marcos.
Das Papier trug unzweifelhaft die Unterschrift des Potentaten. Es war offenkundig über ein Telefax-Gerät von Honolulu nach Europa gelangt und berechtigte de Guzman, Marcos’ Konten bei der SKA abzuräumen.
Für die Bankiers wurde ein Alptraum wahr. Einerseits war Ferdinand Marcos inzwischen weltweit ein geächteter Mann. Tausende von Regimegegnern, das konnte eine empörte Weltöffentlichkeit jetzt täglich nachlesen, hatten zeitweise im Kerker geschmachtet. Folterungen, Mordversuche, Kidnapping und ungezählte Exekutionen gingen auf das Konto des Diktators.
Andererseits war der Schurke geschätzter Kunde des Instituts. Jahrelang hatten die geschicktesten und vertrauenswürdigsten Herren der Bank alle
Kräfte aufgeboten, um das Vermögen des Asiaten zu hüten und zu mehren.
Daß dieser seltsame de Guzman auf die schnelle gute 200 Millionen Dollar hätte abholen können, war Beweis für die gedeihliche Geschäftsverbindung. Sollte das alles vorbei sein, sollte man den Kunden verraten und das Bankgeheimnis, das Fundament des Landes, brechen? Hatte man nicht ähnliche Situationen mit Äthiopiens Kaiser Haile Selassie oder dem Schah von Persien nach einigem Protestgeschrei am Ende still und unbeschadet überstanden?
Doch diesmal war die Lage anders. Zum einen drohten die Dokumente aus dem Regierungspalast Malacañang und aus dem Marcos-Reisegepäck die Verbindungen in die Schweiz ohnehin bloßzulegen. Anders als beim Schah, der alles sorgfältig beiseite geschafft hatte, würden die Bankiers sich nicht taub stellen können.
Zum anderen war inzwischen eine neue Generation von Bankern herangewachsen. Deren Augenmerk richtet sich mehr auf das internationale Geschäft mit Konzernen und milliardenschweren Pensionskassen als auf die bankmäßige Hege von korrupten Potentaten.
Der Riss ging an jenem Märztag quer durch die Führung der SKA.
Josef Dörig und Gerhard Grob, zwei Bedienstete der SKA-Treuhandfirma “Fides”, reagierten auf althergebrachte Art: Dem Kunden musste geholfen werden, gleich was er auf dem Kerbholz hat. Gemeinsam mit De Guzman reisten sie ins nachbarliche Liechtenstein.
Dort, in der Hauptstadt Vaduz, besuchte das Trio den örtlichen Rechtsanwalt Ivo Beck. Der Rechtsgelehrte, der dem verschachtelten Geld-Imperium des Ferdinand Marcos bereits seit Jahren die juristischen Stützen einzog, sollte beim raschen Abtransport der 213 Millionen USD helfen.
Während das Quartett noch darüber nachdachte, die Marcos-Millionen über eine Liechtensteiner-Anstalt mit dem verheißungsvollen Namen “Aurora” diskret in die Freiheit zu schleusen, war in Zürich bereits eine historische Entscheidung gefallen: Aus der Kreditanstalt erreichte den damaligen Schweizer Wirtschaftsminister Kurt Furgler ein Anruf.
Die Situation sei da, fasste ein Bankier die Lage zusammen, nachdem er die Geschichte von De Guzman erzählt hatte. Morgen wolle der Filipino das Geld abheben.
Furgler reagierte rasch. Eine glückliche Fügung hatte die Schweizer Regierung an diesem Tag zusammengeführt. Eigentlich galt es, mit dem finnischen Staatspräsidenten Mauno Koivisto freundschaftlich ein Gläschen zu heben. Nun wurde der Empfang anders genutzt.
Die Regierungsmitglieder steckten in einer Saalecke die Köpfe zusammen und fassten einen für schweizerische Verhältnisse revolutionären Beschluß: Alle Vermögenswerte der Familie Marcos von ihr nahestehenden Personen oder Gesellschaften sind vorsorglich bis auf weiteres zu sperren.
Konservative Schweizer konnten es kaum fassen. Die “Neue Zürcher Zeitung”, sonst Arm in Arm mit Banken und Regierung, beklagte einen »Handstreich«. Den »Ruf des Landes in Gefahr« sah ein prominenter Banker. Weil das so war, wählte die SKA eine einfühlsame Doppelstrategie.
Einerseits hatte die Bank alles ins Rollen gebracht. Andererseits rügte sie, dass die Regierung den “Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt” habe. Die auf Diskretion und Sicherheit bedachte Kundschaft sollte ruhiggestellt werden.
Michael de Guzman jedenfalls konnte mit seiner Marcos-Vollmacht nun nichts mehr anfangen. Aber der Filipino, der in Österreich eine kleine Bank namens “Export-Finanzierungsbank GmbH” führte, ließ so schnell nicht locker. Vier Monate nach der missglückten März-Aktion erschien er wieder in Zürich. Diesmal versuchte er die Schweizer für die Idee zu gewinnen, die 213 Millionen USD statt zu Marcos nach Hawaii zu der neuen Regierung nach Manila zu schicken.
Das klang gut, wäre da nur nicht eine kleine Bedingung gewesen. De Guzman wollte das Geld über seine Wiener Bank nach Manila leiten. Die Schweizer Bankiers und auch die Anwälte der Philippinen in der Schweiz zögerten: Wollte da ein cleverer Abstauber Profit aus dem allgemeinen Wirrwarr ziehen?
Zur Bekräftigung seiner ehrbaren Absichten brachte de Guzman ein neues Papier. Diesmal bestätigt Sedfrey Ordonez, der Generalstaatsanwalt in Manila, der dem Marcos-Vermögen nachspürte, dass alles seine Richtigkeit habe.
Ordonez reiste extra nach Europa, um die Überweisung auf den richtigen Weg zu bringen. In Wien bat er das Finanzministerium, dafür zu sorgen, dass die Marcos-Gelder in die rechtmäßigen Hände gelangen, wenn sie über die “Export-Finanzierungsbank” flössen.
Als wollte er seinem Anliegen Nachdruck verleihen, hatte Ordonez noch einen finster blickenden Filipino-General namens Jesus Almonte mitgebracht. Die Österreicher zuckten nur mit den Schultern: Wie sollten sie den Geldverkehr zwischen privaten Banken beeinflussen? Am Ende wurde aus dem Geldtransfer wieder nichts.
Die Ereignisse nahmen eine verblüffende Wende, als in der Schweiz Post aus Honolulu eintraf. Ferdinand Marcos persönlich schrieb einem seiner zahlreichen Schweizer Anwälte einen Brief. Der Ex-Präsident behauptete, überhaupt kein Geld in der Schweiz zu besitzen, einen “Mik” de Guzman nicht zu kennen und ihm schon gar keine Vollmacht gegeben zu haben. Dass der abgehalfterte Diktator wusste, dass Michael de Guzman “Mike” unter seinen Spezis heißt, spricht für eine Notlüge.
De Guzman reagierte auf den Brief aus Honolulu äußerst geschmeidig: Rasch wechselte er das Lager. Im September unterzeichnete Cory Aquino eine Vollmacht, die nun De Guzman, Ordonez und den General Almonte mit der Heimbringung des Geldes beauftragte.
Zur Verblüffung der Schweizer hielt das Verwirrspiel an. Ein paar Wochen später wurde auch diese Vollmacht, diesmal aus Manila, widerrufen.
Des Rätsels Lösung: Auf den Philippinen war der alte Marcos-Gefolgsmann und Verteidigungsminister Juan Ponce Enrile nach einem Putschversuch gegen Cory Aquino gefeuert worden. Damit aber stand General Almonte, ein Gefolgsmann Enriles, im Verdacht, das Geld in die falsche Richtung schieben zu wollen. Man sieht, was alles bei der Abwehr eines Putsches zu bedenken ist.
Wie reich war er denn nun wirklich?
Bei ihren Nachforschungen begannen die Filipinos an der Quelle und kramten in Ferdinand Marcos alten Steuererklärungen. 1966, in seinem ersten Amtsjahr, beschwor der Präsident ein Netto-Einkommen von 63.000 USD. Nicht mehr als 15.000 USD war sein Gehalt. Den Rest bezog Marcos aus Anwaltsgebühren und dem Verkauf von Lebensmitteln, die sein heimatliches Anwesen abwarf. Sein Vermögen zu dieser Zeit bezifferte er auf etwa 30.000 USD, “Bücher und verschiedene Werte”.
Von seinem Freund Ronald Reagan stammt die einfühlsame Bemerkung, dass “sein Gehalt äußerst bescheiden war und ihn offenkundig nie hätte reich machen können”. Aber, so fuhr Amerikas Präsident fort, “ich dachte immer, dass er schon Millionär war, als er sein Amt antrat”. Reagan hatte recht.
“Marcos war schon vor seinem Amtsantritt der bekannteste Schwarzgeld-Händler in Manila”, sagt Ex-Bankier Antonio Gatmaitan. Wer Pesos in Dollar verwandeln wollte, bediente sich in den frühen sechziger Jahren tunlichst des Senatsmitglieds Ferdinand Marcos von der nationalistischen Partei.
Eine besonders beliebte Art der Geldmutation fand zwischen Manila und der britischen Kronkolonie Hongkong statt. Aus dem überfüllten Stadtstaat strebten, und streben heute noch, Zehntausende von geflüchteten Chinesen in ein neues Heimatland im Pazifik. Die Philippinen bieten den geschäftstüchtigen Chinesen Raum und Entfaltungsmöglichkeiten.
Um aber in Manila amtliche Papiere zu erhalten, ist Geld nötig. Fachleute kalkulieren die Schmiermasse derzeit auf umgerechnet 25.000 Deutsche Mark. Hier setzt das Geschäft der Schwarzgeld-Strategen an. Während der Filipino in Manila für örtliche Pesos die Genehmigung besorgt, hinterlegt der Chinese in Hongkong auf einem Treuhandkonto den entsprechenden Dollarbetrag, plus stattlicher Spesen, versteht sich.
Marcos pflegte dieses Geschäft schon zu einer Zeit, als es für zwei philippinische Pesos noch einen Dollar gab. Heute, nachdem der Potentat sein Land an den Rand des Ruins gewirtschaftet hat, wechseln seine Nachfahren nur noch zwanzig zu eins.
Seine ersten Dollar schleppte Marcos nach Amerika, dem bevorzugten Fluchtland wohlhabender Filipinos. Ein Kontoauszug der Chase Manhattan Bank vom Juli 1967 weist 215.000 USD aus.
Um diese ersten, bescheidenen Früchte des präsidialen Erwerbstriebs rankt sich eine eigentümliche Geschichte. Kontoauszüge der Chase Manhattan gelangten nämlich in die philippinische UN-Vertretung in New York. Sei es, daß in der Bank eine Panne passierte oder dass ein Marcos-Vertrauter als Adressat gedacht war: Jovito Salonga jedenfalls, der sich bereits damals mit seinem ehemaligen Parteifreund überworfen hatte, bekam in Manila Wind von den Dollar.
Doch Salonga konnte wettern, soviel er wollte. Die Summe regte in Manila niemanden so recht auf. Ferdinand Marcos lernte aus dem peinlichen Zwischenfall. Im Jahr darauf begab er sich in die Obhut von Fachleuten. In Manila erschienen Abgesandte der Schweizerischen Kreditanstalt.
Die Nachwelt verdankt es der Aktenliebe des Rechtsanwalts Marcos, dass die ersten Kontakte dokumentarisch erhalten sind. Wenn auch fragmentarisch, so geben die Unterlagen erstmals Einblick in die sagenumwobene Tätigkeit schweizerischer Bankiers.
Wichtig waren zunächst einmal Visitenkarten. Von den vielsprachigen Schweizern hinterließ Walter Fessler, damals oberster Anlageberater der SKA, sein französisches Modell: Ferdinand Marcos hatte fortan regen Kontakt mit dem “Directeur du Credit Suisse”.
Charles Souviron wies seine Internationalität durch zwei Kärtchen aus. Neben seinem richtigen Namen hinterließ er auch die Variante “Carlos” Souviron. Den sorgfältigen Schweizern war bei der Reisevorbereitung nicht entgangen, daß die Philippinen fast 400 Jahre unter spanischer Kolonialherrschaft gelebt hatten.
Ernest Scheller, heute Chef-Anlageberater der SKA, legte Zeugnis ab für die beispielhafte Diskretion der eidgenössischen Bankiers. Er hinterließ eine Visitenkarte, die außer seinem Namen nur den Ort Zürich, die Postleitzahl 8021 und das Postschließfach 590 verriet.
Als Vierter schließlich machte Rolf Klein in Manila seine Aufwartung. Er agierte als Repräsentant der Bank in Hongkong, sozusagen als Schleusenwärter. In dringenden Fällen konnte er in zwei Flugstunden bei dem neuen vielversprechenden Kunden sein.
Im März 1968 begann dann eine langanhaltende, gedeihliche Geschäftsverbindung. Ferdinand und Ehefrau Imelda Marcos eröffneten auf einen Schlag vier Konten. Es waren drei Girokonten und ein Wertpapierkonto, die auch gleich an Ort und Stelle mit einer Grundausstattung versehen wurden.
Entweder war keine Schreibmaschine zur Hand, oder die Herrschaften waren des Tippens unkundig: Walter Fessler, der später ganz nebenbei das philippinische Konsulat in einer Zürcher SKA-Filiale führte, quittierte handschriftlich vier Schecks über insgesamt 950.000 USD.
Die Schecks waren auf ein Kreditinstitut im kalifornischen Beverly Hills bezogen. Ferdinand Marcos war offenbar bemüht, seine Bankverbindungen breit zu streuen und so dem zu erwartenden Geschäftsvolumen anzupassen.
Die Details der Konteneröffnung, denen die neuen Partner viel Mühe widmeten, geben ein Rätsel auf.
Einerseits liefen fortan zwei Konten geradezu offiziell unter dem Inhabernamen “Ferdinand E. Marcos”. Für das Girokonto Nr. 362049 ließ sich der Potentat eine Woche später ein herkömmliches Scheckheft mit 50 Schecks aus Zürich schicken, das er ordnungsgemäß quittierte.
Andererseits wurden die beiden anderen Konten unter den Decknamen »William Saunders« und »Jane Ryan« eingerichtet. Es hat den Anschein, dass die philippinischen Herrscher den Möglichkeiten, die der Direktor Fessler ihnen offerierte, eine kindliche Freude abgewinnen konnten. Imelda unterschrieb die diversen Formulare stets zweimal. Hinter ihren korrekten Namen fügte sie in Klammern hinzu »wahrer Name«. Wenn sie mit “Jane Ryan” unterzeichnete, schrieb sie “Pseudonym” hinzu.
Gatte Ferdinand übte auf seinem offiziellen Briefpapier die neue Identität ein. Offenkundig bereitete es ihm Schwierigkeiten, den “William” mit gewohntem Schwung aufs Papier zu bringen. Siebenmal setzte er zu Unterschriftsproben an. Mehrfach glitschte ihm ein “l” hinter das Eingangs-“W”. Schließlich aber hatte er den Bogen raus und versah den “William Saunders” sogar mit dem gleichen schwungvollen Unterstrich wie seine präsidiale Signatur.
Die Gespräche mit den Abgesandten aus der Schweiz zogen sich zwei Tage hin: Es gab ja noch so viel zu erörtern. So vereinbarten die Gesprächspartner eine komplizierte Code-Sprache, um stets sicher sein zu können, dass Mitteilungen aus Manila oder Zürich nicht in falsche Hände geraten konnten.
Aus den Notizen geht hervor, welcher Mühe ein Schweizer Bankier sich im internationalen Geschäft zu unterziehen hat. Marcos wies darauf hin, dass die Orders nicht nur aus Manila, sondern auch »von anderen Orten wie Hongkong, Taipeh, Tokio usw.« kommen konnten. Es galt daher, den Absender stets zweifelsfrei zu identifizieren.
Die Runde beschloss, allen Mitteilungen das Kürzel “for GEF” mitzugeben. Das würde bedeuten, dass entweder Fessler oder Souviron in Zürich das Papier direkt auf den Tisch bekämen. Außerdem sollten alle Telegramme durchlaufend nummeriert werden.
Dass dem schweizerischen Bankwesen Züge von trivialer Kriminalliteratur anhaften, belegt die nächste Sicherungsstufe. Die Bankdirektoren und der Staatspräsident vereinbarten, dass den Nummern stets noch ein Codewort beigefügt werden sollte.
Zu Nummer eins gehörte “Zucker”, dann sollten “Copra”, “Sperrholz”, “Kupfer” und andere landesübliche Produkte folgen. Überdies sollte je nach Absendemonat ein Phantasiename die Mitteilungen narrensicher gestalten.
Wiederum auf dem Präsidenten-Papier des Regierungspalast Malacañang schrieben die Partner die komplizierten Abmachungen auf, damit ja keine Missverständnisse auftreten konnten. Nachdem der Weg von Asien nach Europa vereinbart war, ging es noch um die umgekehrte Route. Ferdinand und Imelda wiesen die Schweizer in den Kontoeröffnungsformularen handschriftlich an, alle Post an einen – zweifellos fiktiven – “Antonio Martinez” in Manila an eine Postfachadresse zu schicken.
Die Mitteilungen, notierte Marcos, seien in »einem doppelten Briefumschlag« zu verschließen, wobei der “innere Umschlag unbeschriftet” sein sollte. – Spiegel/RM










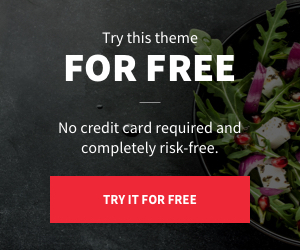
Add Comment